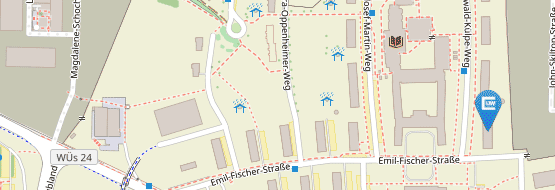Abschlussarbeiten
Prof. Dr. Frank Schwab
Im Mittelpunkt der Themen für ihre Arbeiten stehen evolvierte und emotionale Phänomene bei der Mediennutzung. Aber auch Themen aus dem Bereich Gesundheitskommunikation (Schwerpunkt Suizidprävention) oder Internen Unternehmenskommunikation sind möglich.
Wie Themenfindung und Betreuung ablaufen
Wenn Sie sich für ein Thema erstprioritär interessieren, melden Sie sich per Mail mit ihren ersten Ideen zum Thema. Nach der Zuordnung zu unserem Arbeitsbereich und dem/der Betreuer:in findet eine Erstbesprechung statt. Dabei klären wir eine mögliche Studie, die grundlegende Fragstellung, die relevanten Konstrukte (z.B. UVs, AVs) und Literatur zum Einstieg ins Thema. Wir berücksichtigen Ihre Interessen, Fragestellungen oder weitere Konstrukte, wenn möglich. In den folgenden Besprechungen legen wir dann gemeinsam die finale Fragestellung, das Design und das methodische Vorgehen fest.
Sie haben eine vielversprechende Forschungslücke gefunden, die hier nicht benannt wird? Überzeugen Sie mich. Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung und Umsetzung eigener Ideen, wenn wir beim Thema zusammenfinden können.
Arbeiten sie mit bei: SuiLearning - Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines E-Learning Programms “Grundkurs Suizidprävention im Gesundheitswesen“
Fragestellung: Wie gestaltet man das Thema Suizidprävention erfolgreich als digitale Lernumgebung?
Jährlich sterben über 10.000 Menschen durch Suizid in Deutschland – Prävention ist dringend notwendig. Ein bundesweites E-Learning-Programm soll alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen schulen. Ziel ist der Erwerb zentraler Kompetenzen im Erkennen, Verstehen und Handeln bei Suizidalität. Das Programm umfasst bis zu mehrere Module mit Texten, Grafiken, Animationen und Videos. In einer Studie mit 500 Teilnehmenden wird das Programm wissenschaftlich evaluiert. Anschließend wird es frei online verfügbar gemacht, um breite Wirkung zu erzielen. Studierende können mit ihrer Abschlussarbeit aktiv zur Suizidprävention beitragen und hier mitwirken. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/gesundheitsfoerderung-und-praevention/suilearning.html
Für einen ersten Forschungsüberblick: https://www.naspro.de/dl/Suizidpraevention-Deutschland-2021.pdf
Fashion, Beauty and the Media
Wie formen Medien unser Verständnis von Schönheit und Mode? In diesem Themenfeld analysieren sie Trends, Ideale und Inszenierungen nicht nur kritisch sondern auch aus einer evolutionären Perspektive. Wir untersuchen psychologische, kulturelle und mediale Aspekte. Praxisorientiert schauen wir in die Beauty- und Fashion-Welten. Soziale Medien, Ästhetik und Identität könnten im Zentrum der Diskussion stehen. Studierende erforschen, wie Medien alte (auch archaische) Muster neu inszenieren. Eine spannende Grundlage für Abschlussarbeiten mit aktuellem Bezug!
Mögliche Fragestellung: Wie beeinflussen Kleidung, Accessoires oder Körperinszenierungen (etwa Schminken) die medienvermittelte Personenwahrnehmung (Insta, Youtube, Selfies)?
Evolutionary Media Psychology
Fragestellung: Warum nutzen wir Medien – aus evolutionspsychologischer Sicht?
Basierend auf Darwins Theorien untersuchen wir Mediennutzung und -wirkung. Sind Medien Anpassungen an evolutionäre Probleme oder nur Nebenprodukte? Mögliche Themen sind: Digitale Partnerwahl oder Geschlechterunterschiede bei Medienphänomenen. Weitere Beispiele sind: Faszination für Horror, Online-Dating, Romantische Komödien, Supernormale Medieninszenierungen. Wir analysieren mediale Phänomene mit evolutionären Erklärungsansätzen. Ein spannendes Forschungsfeld für Abschlussarbeiten mit psychologischem Fokus!
Für einen ersten Forschungsüberblick:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-48028-8_5
PD Dr. habil. Astrid Carolus
Im Mittelpunkt der Themen für ihre Arbeiten stehen KI-Chatbots, die als eine Art Gesprächspartner begriffen werden. Ausgehed von der Idee der Medie Equation und dem Paradigma Computers As Social Actors sind Sie eingeladen, in ihrer Arbeit Begegnungen zwischen menschlichen Usern und KI-basierte Chatbots zu untersuchen.
Wie Themenfindung und Betreuung ablaufen
Wenn Sie sich für ein Thema interessieren, melden Sie sich per Mail mit ihren ersten Ideen zum Thema. Bei der Erstbesprechung erhalten Sie zu dem von Ihnen gewählten Gebiet einen Steckbrief, der eine mögliche Studie skizziert und dabei u.a. die grundlegende Fragstellung, die relevanten Konstrukute (z.B. UVs, AVs) und Literatur zum Einstieg ins Thema nennt. Die Steckbriefe dienen als eine erste Orientierung im Feld. Sie ergänzen diese um Ihre Interessen, Fragestellungen oder weitere Konstrukute. In den folgenden Besprechungen legen wir dann gemeinsam die finale Fragestellung, das Design und das methodische Vorgehen fest.
Sie haben eine vielversprechende Forschungslücke gefunden, die hier nicht benannt wird?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung und Umsetzung Ihrer eigenen Ideen.
Ich-Botschaften und Empathie gegenüber Chatbots
Fragestellung: Welche Variablen beeinflussen, was und wie viel wir Chatbots über uns erzählen und wie viel Empathie wir ihnen gegenüber zeigen?
Für einen ersten Forschungsüberblick:
de Sá Siqueira, M. A., Müller, B. C. N., & Bosse, T. (2024). When do we accept mistakes from chatbots? The impact of human-like communication on user experience in chatbots that make mistakes. International Journal of Human–Computer Interaction, 40(11), 2862–2872. https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2175158
DeVrio, A., Cheng, M., Egede, L., Olteanu, A., & Blodgett, S. L. (2025). A taxonomy of linguistic expressions that contribute to anthropomorphism of language technologies. Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–18. https://doi.org/10.1145/3706598.3714038
Liebrecht, C., & van Hooijdonk, C. (2020). Creating humanlike chatbots: What chatbot developers could learn from webcare employees in adopting a conversational human voice. In A. Følstad, T. Araujo, S. Papadopoulos, E. L.-C. Law, O.-C. Granmo, E. Luger, & P. B. Brandtzaeg (Hrsg.), Chatbot Research and Design (Bd. 11970, S. 51–64). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39540-7_4
Vertrauen in Chatbots
Fragestellung: Wie beeinflussen Eigenschaften eines Chatbots die Kompetenz, die User dem Chatbot zuschreiben oder das Vertrauen, das sie in Chatbot haben?
Für einen Forschungsüberblick:
Carolus, A., Schmidt, C., Muench, R., Mayer, L., & Schneider, F. (2018). Pink Stinks - at Least for Men: How Minimal Gender Cues Affect the Evaluation of Smartphones. In M. Kurosu (Hrsg.), Human-Computer Interaction. Interaction in Context (Bd. 10902, S. 512–525). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91244-8_40
Fietta, V., Zecchinato, F., Stasi, B. D., Polato, M., & Monaro, M. (2022). Dissociation Between Users’ Explicit and Implicit Attitudes Toward Artificial Intelligence: An Experimental Study. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 52(3), 481–489. https://doi.org/10.1109/thms.2021.3125280
Mitgefühl mit dem Chatbot
Fragestellung: Reagieren wir empathisch auf einen Chatbot - z. B. wenn dieser unfreundlich oder ruppig behandelt wird?
Für einen ersten Forschungsüberblick:
Carolus, A., Wienrich, C., Törke, A., Friedel, T., Schwietering, C., & Sperzel, M. (2021). ‘Alexa, I feel for you!’ Observers’ empathetic reactions towards a conversational agent. Frontiers in Computer Science, 3. https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.682982
Rosenthal-von der Pütten, A. M., Krämer, N. C., Hoffmann, L., Sobieraj, S., & Eimler, S. C. (2013). An experimental study on emotional reactions towards a robot. International Journal of Social Robotics, 5(1), 17–34. https://doi.org/10.1007/s12369-012-0173-8
Rosenthal-von Der Pütten, A. M., Schulte, F. P., Eimler, S. C., Sobieraj, S., Hoffmann, L., Maderwald, S., Brand, M., & Krämer, N. C. (2014). Investigations on empathy towards humans and robots using fMRI. Computers in Human Behavior, 33, 201–212. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.004
Ähnlichkeit von Chatbot und User
Fragestellung: Werden Chatbots als attraktiver wahrgenommen, wenn sie dem User ähneln?
Für einen Forschungsüberblick:
Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. Journal of social issues, 56(1), 81-103.
Dr. Michael Brill
Großes Kino und große Gefühle: Wie schafft es der Film, uns ins Kino zu locken oder vor dem Fernseher zu halten? In verschiedenen Bachelorarbeitsthemen untersuchen Sie die Wirkung von Form und Inhalt des Films auf das Erleben des Publikums, wobei zusätzlich versucht wird, jenseits des klassischen Fragebogens auch objektive Daten zu gewinnen. Möglich ist auch, Aspekte der Medienproduktion mit aufzunehmen, um Stimulusmaterial zu erstellen. Schon vorhandenes Filmmaterial kann mit Medieninhaltsanalysen exakt beschrieben werden.
Wie Themenfindung und Betreuung ablaufen
Wenn Sie sich für ein Thema erstprioritär interessieren, melden Sie sich per Mail mit ihren ersten Ideen zum Thema. Nach der Zuordnung zu unserem Arbeitsbereich findet eine Erstbesprechung statt. Dabei klären wir eine mögliche Studie, die grundlegende Fragestellung, die relevanten Konstrukte (z.B. UVs, AVs) und Literatur zum Einstieg ins Thema. Wir berücksichtigen Ihre Interessen, Fragestellungen oder weitere Konstrukte, wenn möglich. In den folgenden Besprechungen legen wir dann gemeinsam die finale Fragestellung, das Design und das methodische Vorgehen fest.
Sie haben eine vielversprechende Forschungslücke gefunden, die hier nicht benannt wird? Überzeugen Sie mich. Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung und Umsetzung eigener Ideen, wenn wir beim Thema zusammenfinden können.
Fragestellung: Wie beeinflusst die Filmsprache die Aufmerksamkeit und Emotionen des Publikums?
In diesen Themen für Ihre Bachelorarbeit untersuchen Sie, wie filmische Gestaltungsmittel – etwa Einstellungsgröße, Kamerabewegung, Lichtsetzung oder Schnitt – die Aufmerksamkeit und das emotionale Erleben des Publikums beeinflussen. Aber auch Wirkungen auf andere Aspekte der Filmrezeption wie Präsenzerleben oder Transportation sind von Interesse. Zur Datenerhebung lassen sich dabei psychophysiologische Messungen (Herzrate, Hautleitfähigkeit), Verhaltensmaße (mimische Aktivität, Körperbewegung) und Selbstauskunftsverfahren (Fragebogen‐Skalen) einsetzen.
Fragestellung: Wie beeinflusst der Filminhalt die Aufmerksamkeit und die erlebte Spannung des Publikums?
Dieser Themenbereich richtet den Blick auf narrative Elemente und dramaturgische Stilmittel, die in Film und Serie Aufmerksamkeit und Spannung erzeugen. Sie können zum Beispiel untersuchen, welche Erzählstrukturen, Montagetechniken oder emotionalen Themen das Publikum besonders stark mitreißen und wie sich das auf Rezeptionsprozesse der Zuschauenden auswirkt. Die Erhebungsmethoden reichen von Fragebogen-Skalen über Videoaufnahmen bis zu psychophysiologischen Messmethoden.
Alicia Schäfer
Was fasziniert so viele Menschen an True Crime – und welche Spuren hinterlässt der Konsum dieser Inhalte? In Ihrer Bachelorarbeit können Sie sowohl Nutzungsmotive als auch mögliche Effekte von True Crime Formaten auf Erleben, Denken und Handeln der Rezipient:innen untersuchen. Alternativ kann der Fokus auch auf der Analyse der medialen Inszenierung von True Crime Fällen liegen.
Wie Themenfindung und Betreuung ablaufen
Wenn Sie sich für ein Thema erstprioritär interessieren, melden Sie sich per Mail mit Ihren ersten Ideen zum Thema. Nach der Zuordnung zu unserem Arbeitsbereich und dem/der Betreuer:in findet eine Erstbesprechung statt. Dabei klären wir eine mögliche Studie, die grundlegende Fragestellung, die relevanten Konstrukte (z.B. UVs, AVs) und Literatur zum Einstieg ins Thema. Wir berücksichtigen Ihre Interessen, Fragestellungen oder weitere Konstrukte, wenn möglich. In den folgenden Besprechungen legen wir dann gemeinsam die finale Fragestellung, das Design und das methodische Vorgehen fest.
Sie haben eine vielversprechende Forschungslücke gefunden, die hier nicht benannt wird?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung und Umsetzung eigener Ideen, wenn wir beim Thema zusammenfinden können.
Beispielhafte Themen und Fragestellungen zum Thema True Crime (--> gerne durch eigene Vorschläge erweiterbar):
True Crime als “Guilty Pleasure”?
Fragestellungen: Welche Variablen (z.B. Framing; Priming; Rezeptionssituation…) beeinflussen die moralische Bewertung und das Enjoyment von True Crime?
Unter welchen Bedingungen dient True Crime Konsum der Emotionsregulation und wann wird er als belastend erlebt?
True Crime als “Likes für Leid”?
Fragestellungen: Wie beeinflussen Reichweite von True Crime Beiträgen und deren Inszenierung auf Social Media die emotionale Betroffenheit der Rezipient:innen?
Unter welchen Bedingungen fördern True Crime Inhalte auf Social Media die Perspektivübernahme mit Opfern und verhindern die Heroisierung von Täter:innen?
True Crime als “Safe Space”?
Fragestellungen: Wie können True Crime Formate dabei helfen, Vorurteile abzubauen (z.B. mit Blick auf Victim Blaming) und Stigmatisierung (z.B. von psychischen Erkrankungen) zu bekämpfen?
Wie können Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft unter den Rezipient:innen erhöht werden?
Catharina Münch
Im Mittelpunkt der angebotenen Bachelorarbeitsthemen steht das digitale Wohlbefinden im Umgang mit modernen Technologien wie Smartphones und KI-Anwendungen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Schulkontext: Wie gehen Lehrkräfte mit digitalen Technologien um? Welche Rolle spielen dabei Selbstwirksamkeit, Technikbereitschaft und digitale Belastungen?
Wie Themenfindung und Betreuung ablaufen
Wenn Sie sich für ein Thema erstprioritär interessieren, melden Sie sich per Mail mit Ihren ersten Ideen zum Thema. Nach der Zuordnung zu unserem Arbeitsbereich und dem/der Betreuer:in findet eine Erstbesprechung statt. Dabei klären wir eine mögliche Studie, die grundlegende Fragestellung, die relevanten Konstrukte (z.B. UVs, AVs) und Literatur zum Einstieg ins Thema. Wir berücksichtigen Ihre Interessen, Fragestellungen oder weitere Konstrukte, wenn möglich. In den folgenden Besprechungen legen wir dann gemeinsam die finale Fragestellung, das Design und das methodische Vorgehen fest.
Sie haben eine vielversprechende Forschungslücke gefunden, die hier nicht benannt wird?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung und Umsetzung eigener Ideen, wenn wir beim Thema zusammenfinden können.
Digital Wellbeing im Umgang mit Smartphones & KI
Smartphones sind alltägliche Begleiter – auch im Berufsleben von Lehrkräften. Doch ständige Erreichbarkeit, Informationsflut und medienbedingter Stress können sich negativ auf das digitale Wohlbefinden auswirken. In diesem Themenfeld untersuchen Studierende, wie Smartphone-Nutzung das emotionale Erleben, die Selbstregulation und das Stressempfinden beeinflusst. Auch Digital Nudging oder digitale Detox-Strategien können hier im Mittelpunkt stehen.
Fragestellungen allgemein: Wie wirken sich verschiedene digitale Nudges (z. B. Graustufenmodus, App-Limits) auf Mediennutzungsverhalten und Wohlbefinden aus? Welche Rolle spielen Persönlichkeitsfaktoren (wie z.B. Selbstkontrolle, Neurotizismus, Technikbereitschaft) dabei? Wie beeinflussen personalisierte vs. generische digitale Nudges die Smartphone-Nutzung und das Wohlbefinden? Welche Nudges werden von Nutzer:inenn als hilfreich oder störend empfunden und warum?
Fragestellungen im KI-Kontext: Inwiefern kann die Nutzung von KI-gestützten Zeitmanagement-Apps zur Stressreduktion beitragen? Fördern menschlich gestaltete KI-Interaktionen (z. B. durch Sprache oder Design) das Wohlbefinden von Nutzenden? Wie kann KI-basiertes Feedback (z. B. durch Chatbots wie Chat GPT oder Apps) genutzt werden, um achtsame Smartphone-Nutzung zu fördern?
Für einen ersten Forschungsüberblick:
Muench, C., & Carolus, A. (2024). Analyzing Smartphone Separation vs. Restriction on Users’ Well-Being During a Pandemic. In K.Arai (ed.), Future and Technologies Conference (FTC) 2024, Volume 2, Lecture Notes in Networks and Systems, 1155 (266-296). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73122-8_17
Radtke, T., Apel, T., Schenkel, K., Keller, J., & von Lindern, E. (2022). Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review. Mobile Media & Communication, 10(2), 190-215. https://doi.org/10.1177/2050157921102864
Roffarello, A. M., & De Russis, L. (2023). Achieving digital wellbeing through digital self-control tools: A systematic review and meta-analysis. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 30(4), 1-66. https://doi.org/10.1145/3571810
Vanden Abeele, M. M. (2021). Digital wellbeing as a dynamic construct. Communication Theory, 31(4), 932-955. https://doi.org/10.1093/ct/qtaa024
Weinmann, M., Schneider, C., & Brocke, J. V. (2016). Digital nudging. Business & Information Systems Engineering, 58(6), 433-436. https://doi.org/10.1007/s12599-016-0453-1
Digital Wellbeing & KI im Schulkontext
Der Einsatz von KI-basierten Tools wie adaptiven Lernplattformen, Chatbots oder automatisiertem Feedback gewinnt im Bildungsbereich zunehmend an Bedeutung. Lehrkräfte stehen dabei zwischen technologischem Fortschritt, erhöhten Anforderungen und dem Wunsch nach pädagogischer Kontrolle. Dieses Themenfeld widmet sich der Frage, wie KI-gestützte Systeme das digitale Wohlbefinden von Lehrkräften beeinflussen – etwa durch wahrgenommenen Kontrollverlust, Stress, Technikakzeptanz oder emotionale Reaktionen auf die Mensch-Maschine-Interaktion im schulischen Alltag.
Fragestellungen: Welche Rolle spielt digitales Wohlbefinden bei der Integration neuer Technologien in die Unterrichtspraxis? Wie verändert sich das Wohlbefinden von Lehrkräften durch den regelmäßigen Einsatz KI-gestützter Assistenzsysteme im Unterricht? Wie beeinflussen Technikbereitschaft und wahrgenommene Selbstwirksamkeit das digitale Wohlbefinden von Lehrkräften im Umgang mit KI-basierten Unterrichtstools?
Für einen ersten Forschungsüberblick:
Carolus, A., & Münch, C. (2022). " Ins Off zu Lehren ist wie liebevoll-aufwändiges Kochen für Freunde, ohne das Verspeisen zu erleben": Medienpsychologische Perspektive auf das Lehren in Zeiten einer Pandemie. MedienPädagogik, 46, 198-231. https://doi.org/10.21240/mpaed/46/2022.05.13.X
Münch, C., Carolus, A., Bierhalter, L., & Füting-Lippert, A. (2024). ‹ Smart School–oder doch lieber Old School?›: Psychologische und pädagogische Analysen der Sichtweisen von Studierenden des Grundschullehramts auf Smartphones im Klassenzimmer. MedienPädagogik (Occasional Papers), 34-68. https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2024.01.11.X
Ortí Martínez, J. A., Pardo Ríos, M., Burgueño López, J., & Plitt Stevens, J. (2024). AI as a Tool for Educational Transformation: Keys for Responsible Implementation Fostering Digital Well-being. Octaedro Editorial. https://doi.org/10.36006/09643-1
Yu, F., Mirza, F., Chaudhary, N. I., Arshad, R., & Wu, Y. (2022). Impact of perceived skillset and organizational traits on digital wellbeing of teachers: Mediating role of resilience. Frontiers in Psychology, 13, 923386. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.923386