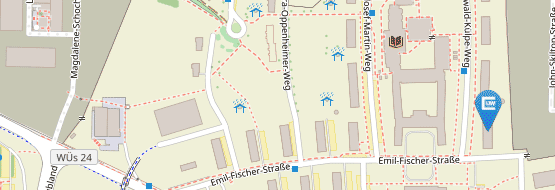Abschlussarbeiten
Hier finden Sie einen Überblick der Themen für Abschlussarbeiten.
Alle Themen können im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit behandelt werden. Auch Ihre eigenen Ideen sind willkommen. Melden Sie sich gerne mit Fragen per Mail.
Ausschreibung Bachelorarbeiten im WS 2024/25
Aktuell laufen diese Projekte, in die Sie mit Ihrer Abschlussarbeit einsteigen können:
Breitere Themenfelder für Ihre Abschlussarbeit
Die Psychologie der Nutzung digitaler Technologien
Sind wir doch mal ehrlich: Mit wem verbringen wir die meiste Zeit? Partner:in, Familie, Freund:innen? Oder doch eher mit dem Smartphone? In Zukunft dann vielleicht mit einer Künstlichen Intelligenz? Werden wir dann mit einer KI zusammenarbeiten, unsere Freizeit verbringen oder uns gar in eine KI verlieben?
Erstmal nicht richtig vorstellbar. Wir können doch Menschen von Technik unterscheiden!
Können wir - zumindest in den meisten Fällen. Und dennoch können digitale Technologien wie z.B. das Smartphone oder Sprachassistenten und Chatbots in ihren menschlichen Anwender:innen soziale Reaktion auslösen - fast so als handelt es sich nicht um Mensch‐Technik‐Interaktionen, sondern um Mensch-Mensch-Interaktionen. In diesem Forschungsbereich verstehen wir Technologien daher als psychologisch relevante digitale Entitäten, die ähnlich wie Menschen Eindrücke, Empfindungen und Gefühle auslösen können.
Ziel der Arbeiten in diesem Themenfeld: Beschreibung, Analyse und Erklärung von Mensch-Technik-Interaktionen und Mensch-Technik-Beziehungen. Menschliche Reaktionen auf Technologien, auf sozialer, emotionaler, kognitiver und konativer Ebene.
Zu vergebende Abschlussarbeiten:
- Was stellen sich User unter KI (ChatGPT) vor?
- Kann KI unser Freund werden?
- Reagieren User in Unterhaltungen mit der KI so wie in Unterhalten mit anderen Menschen?
- ...
- ... oder Sie melden sich mit Ihrem eigenen Thema
Abgeschlossene Arbeiten der letzten Jahre:
- Hey Google, Alexa & Co., was ist Privacy? - Entwicklung und erste Schritte der Validierung ,der Voice Assistant Privacy Literacy Scale.
- Interacting with a conversational agent – the effects of anthropomorphism and modality on learning privacy literacy
- Media Equation 2.0: Wie Reziprozität die intime Selbstoffenbarung in der Interaktion zwischen Mensch und Smartphone beeinflusst.
- Geschlechterkampf der Stimmen – Geschlechtseffekte bei Selbstauskünften in der Interaktion mit einem Smartphone.
- Mein Smartphone, mein allzeit treuer Begleiter – Soziale Phänomene in der Interaktion mit dem eigenen Smartphone im Vergleich zu einem fremden Smartphone.
- Smartphones are social actors – Der Einfluss von Höflichkeit und Geschlecht eines Smartphones.
Digitale Technologien und die (mentale) Gesundheit
Digitale Technologien bieten zweifellos zahlreiche Vorteile. Sonst würden sie wohl kaum so intensiv genutzt werden. Allerdings, das ist viel von uns auch irgendwie bewusst, geht die Nutzung auch mit unterschiedlichen Risiken einher: ungewollte Preisgabe von Daten, übermäßige Nutzung bis hin zur Sucht, problematische Medieninhalte, die krank machen können, Vereinsamung, schlechtere Schulleistungen, ... die Liste ist lang. Die Arbeiten in diesem Forschungsfeld gehen einerseits den Risiken auf die Spur und fragen, wie schlimm ist es wirklich? Ist es für alle gleich bedrohlich oder sind bestimmte Risikogruppen besonders betroffen und andere gar nicht? Und dann fragen wir auch andersherum: Was sind die positiven Effekte digitaler Technologien? Wo liegen Potentiale für die Gesundheit? Und was müssen Menschen für ein gesundes Leben in einer digitalisiertem Welt wissen, können und tun? Und wie können wir die Menschen dabei unterstützen?
Ziel der Arbeiten in diesem Themenfeld: Analyse, Beschreibung und Erklärung der Nutzung und Wirkung digitaler Medien mit dem Schwerpunkt Gesundheit
Zu vergebende Abschlussarbeiten:
- Digital Detox - Wie gelingt die selbstbestimmte Nutzung digitaler Technologien?
- Well Being trotz oder gerade wegen digitaler Technologien?
- Digitale Technologien zur Stressbewältigung
- ...
- ... oder Sie melden sich mit Ihrem eigenen Thema
Abgeschlossene Arbeiten der letzten Jahre:
- Nudge for your life! Endlich mal abschalten? Die Effekte einer auf Digital Nudging basierenden Intervention zur Reduktion der Smartphone-Nutzung auf das Nutzungsverhalten und Wohlbefinden als Maßnahme gegen den Einfluss von FoMO und Online Vigilance.
- „I’m addicted to you”: Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen Smartphone-Sucht, der tatsächlichen Smartphone-Nutzung und der mentalen Gesundheit von Student:innen.
- Post it! Or not? Zusammenhänge zwischen der aktiven versus passiven Nutzung von Instagram und dem Wohlbefinden unter Berücksichtigung von Sozialem Kapital, Sozialem Aufwärtsvergleich und Feeling left out sowie die Rollen von Mindfulness und Self-Compassion.
- Liking or Lurking? Der Zusammenhang zwischen aktiver versus passiver Instagram-Nutzung und Lebenszufriedenheit sowie die Rolle von Sozialem Kapital, Sozialem Aufwärtsvergleich, Feeling left out, Self-Compassion und Mindfulness.
- The Power of Self-Compassion - How to Survive Living in Today’s Always-On Culture.
- One quick needlestick, one giant leap for mankind: How to increase COVID-19 vaccination intention via infographics.
- Namasté Selbstliebe: Die Wirkung von #yoga-, #fitspiration- und #selflove-Bildern auf Instagram auf die Stimmung und Selbstachtung.
- Body vs. Mind: Eine Studie zur Wirkung der Rezeption von #Fitspiration-, #Yoga- und #Selbstliebe-Beiträgen auf Instagram auf das eigene Körperbild.
- Social Smombies –Zusammenhänge zwischen WhatsApp-Nutzung und sozialem Kapital.
- “If they can do it, so can I” - How Fitness Influencers improve fitness related self-efficacy beliefs.
Digitalkompetenzen von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden, von Kindern und Eltern professionalisieren
Die gesunde Nutzung digitaler Medien setzt Kompetenzen voraus, die erlernt und geübt werden müssen. Darüber hinaus bestimmte Einstellungen, Überzeugungen und Eigenschaften, die wir als “Digital Mindset” zusammenfassen. Dass wir als Gesellschaft insgesamt hier noch Entwicklungspotenziale erkennen lassen, wissen wir nicht erst seit der COVID19-Krise. Aber die Zeiten von Home Schooling und Home Office haben die Defizite noch einmal unterstrichen. Ausgehend von der Annahme, dass die technischen Ausstattung (Hardware, Software, Internetanschluss) notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für eine kompetente Nutzung digitaler Medien sind, analysieren wir in diesem Themenkomplex die Digitalkompetenzen von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden, von Kindern und Jugendlichen aber auch von ihren Eltern.
Ziel der Arbeiten in diesem Themenfeld: Analyse, Beschreibung und Erklärung des Status Quo und Ableitung von Entwicklungspotentialen; Entwicklung von praktischen Maßnahmen (Fortbildungskonzepten) zur Steigerung der Digitalkompetenzen.
Zu vergebende Abschlussarbeiten:
- Welche Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Künstlicher Intelligenz sollten Schüler:innen haben?
- Wie lassen sich Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Künstlicher Intelligenz an Schüler:innen vermitteln?
- Wie digitalkompetent sind (angehende) Lehrkräfte?
- Welche Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Künstlicher Intelligenz sollten (angehende) Lehrer:innen haben?
- Wie lassen sich Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Künstlicher Intelligenz an Lehrer:innen vermitteln?
- ...
- ... oder Sie melden sich mit Ihrem eigenen Thema
Abgeschlossene Arbeiten der letzten Jahre:
- Digital Native gleich Digital Pro? Digitalkompetenzen angehender Lehrkräfte und die Rolle der Motivation und Selbstwirksamkeit.
- Digitalisierung als Vehikel der Inklusion. Stand und Einflussfaktoren der Digitalkompetenzen von Lehramtsstudierenden und die besondere Rolle der Sonderpädagogik
- Herausforderungen der Corona-Krise in Bezug auf die Digitalisierung des Unterrichts und Auswirkungen der Krise auf kognitive, affektive und konative Aspekte, in Abhängigkeit von Persönlichkeitsfaktoren der Lehrer/innen
- Digitale Schule- Fluch oder Segen? Die Effekte motivationaler und kognitiver Faktoren auf SchülerInnen und Eltern beim Implementierungsprozess von Tablets in den Unterricht.
- Herausforderungen und Auswirkungen der Corona-Krise in Bezug auf die Nutzung von digitalen Medien im Schulunterricht